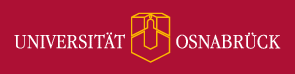Hauptinhalt
Topinformationen
Perspektiven eines Instituts für Kognitionswissenschaft an der Universität Osnabrück
Claus R. Rollinger
Es gibt sehr viele, außerordentlich spannende Fragen, mit denen sich die verschiedenen Wissenschaftszweige beschäftigen und jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler ist davon überzeugt, dass die Frage, an deren Beantwortung sie oder er sitzt, die spannendste und wichtigste überhaupt ist.
Ich möchte hier weder die Frage aufwerfen, warum um Himmels Willen die Menschheit so neugierig ist, wie sie es ganz offensichtlich ist, noch möchte ich darauf hinaus, ob es wichtigere und weniger wichtige Forschungsfragen gibt. Ich möchte Sie vielmehr an die Tatsache heranführen, dass Wissenschaft bzw. das Wissenschaftssystem nichts statisches, sondern etwas hochgradig dynamisches ist. Wir werden sehen, dass diese Dynamik keineswegs nur in einer immer feinkörniger werdenden Ausdifferenzierung der bestehenden Disziplinen besteht, sondern das neue Koalitionen eingegangen werden, die dazu führen, dass große, umfassende Wissenschaftsbereiche entstehen.
Beginnen wir mit der Frage, was eine wissenschaftliche Disziplin ausmacht? Eine – möglicherweise naturwissenschaftlich gefärbte – Antwort auf diese Frage lautet: Es sind der Untersuchungsgegenstand und das Inventar der Methoden, mit dem dieser Untersuchungsgegenstand erforscht wird.
Wenn Antworten gefunden werden und neue Fragen über den Untersuchungsgegenstand formuliert werden, dann kann dies dazu führen, dass auch neue Methoden benötigt werden. Erkenntnisgewinn geht – zumindest in der Wissenschaft – im Grunde immer Hand in Hand mit der Formulierung neuer, aufregender Fragen und der Entwicklung neuer Methoden. Es ist aber ein guter und erprobter Brauch, zunächst in anderen Disziplinen auf Methodensuche zu gehen und – wenn man fündig wird – diese dann für das eigene Fach in Anspruch zu nehmen.
Nehmen wir die Genforschung als Beispiel. Dort steht die Funktionsweise des Genoms im Zentrum. Entschlüsselt hat man bislang – in meiner Terminologie gesprochen – die Syntax, mit der aus Elementarbausteinen komplexe Gebilde zusammengesetzt werden können deren Bedeutung weitgehend unklar ist. Erst wenn wir wissen, wie sie interagieren, was sie bedeuten und bewirken, haben wir verstanden, womit wir es da zu tun haben. Fragen nach der Bedeutung und Wirkung sind nunmehr in den Vordergrund gerückt.
Diese neuen, aufregenden Fragen können aber häufig nicht mehr mit dem Handwerkszeug derjenigen Disziplin alleine angegangen werden, die sie aufgeworfen hat. Die Methodenentwicklung funktioniert dann nicht so einfach, wenn Methoden benötigt werden, die eine zusätzliche wissenschaftliche Ausbildung erfordert, die das eigene Fach nicht leisten kann. Im Falle der Genforschung hat dies dazu geführt, dass eine neue Fachrichtung entstanden ist, die Bioinformatik, die sich – sehr verkürzt gesprochen – mit der automatischen Auswertung sehr großer Datenmengen befasst, die von Biologen erzeugt worden sind.
Die Mutterdisziplinen sind sich zwar einig bezüglich der Wichtigkeit ihres neuen Kindes, wohin die Bioinformatik jedoch gehört, ob zur Informatik oder zur Biologie, darüber herrscht noch keine Einigkeit. Das ist aber auch nicht sonderlich wichtig.
Die Informatik selbst ist ein sehr schönes Beispiel für die Entstehung neuer Fachgebiete, an denen verschiedene Mutterdisziplinen beteiligt sind. Ich selbst gehörte zu den allerersten Jahrgängen, die in Deutschland Informatik studieren konnten und damals war keineswegs klar, welchen Siegeszug diese Disziplin angetreten hatte. Heute ist eine Universität ohne Informatik nicht mehr vorstellbar, auch wenn der Ausbaugrad hin und wieder zu wünschen übrig lässt.
Selbst die Grenzen zwischen den großen Wissenschaftsbereichen sind fließend, Gerhard Roth wird uns im Hinblick auf die Hirnforschung näheres über das Verhältnis zwischen Natur- und Geisteswissenschaften berichten.
Das Grundverständnis der Kognitionswissenschaft, so wie wir sie sehen und hier etablieren wollen, kommt dem einer Naturwissenschaft am nächsten. Wir sehen aber keinen Sinn darin, sie scharf von anderen Wissenschaften abzugrenzen, um ihr einen Platz im Wissenschaftssystem zu sichern. Vorrang hat der Erkenntnisgewinn über unseren Untersuchungsgegenstand und es ist jeder willkommen, der hier einen Beitrag leisten kann.
Welches ist aber der Untersuchungsgegenstand, den sich die Kognitionswissenschaft gewählt hat? Hierauf gibt es zwei Antworten.
Die erste lautet, dass es die Hardware ist, das Gehirn als ein Organ, das Erleben, Denken und Handeln derjenigen ermöglicht, die über dieses Organ verfügen. Wie erzeugt das Gehirn diese Funktionalitäten? Wir haben es mit einem vergleichsweise komplizierten Organ zu tun, das Erstaunliches leistet. Ich möchte nur einige wenige Daten erwähnen:
Beim Menschen wiegt das Gehirn im Schnitt zwischen 1,3 und 1,5 Kilo. Das größte Gehirn hat der Pottwal mit durchschnittlich 8,5 Kilo Hirnmasse. Es geht allerdings nicht nach dem Prinzip „the bigger the better“ sondern entscheidend ist das Verhältnis zwischen Gehirngröße und Körpergewicht, also der Größe des Körpers, den ein Gehirn managen muss. Hier schneiden wir erheblich besser ab. Es ist sogar so, dass unser Gehirn größer ist, als es sein müsste, um ausschließlich unseren Körper zu managen. Wir stellen mit diesem Organ also noch irgendetwas anderes an.
Das menschliche Gehirn besteht aus ca. 10 Milliarden Nervenzellen oder Neuronen, die vielfältigst miteinender verbunden sind. Die Größenordnung der Verbindungen ist 1014 oder in Worten: einhundert Billionen. Das sind wahrlich große Zahlen. Axone, d.h. die Verbindungen zwischen Neuronen, können bis zu einem Meter Länge erreichen, d.h., dass auch weit voneinander entfernte Neuronen direkt miteinander verbunden sein können.
Trotz der hohen Vernetzung ist das Gehirn strukturiert; den verschiedenen Arealen kommen scheinbar spezielle, identifizierbare Aufgaben zu. Es ist andererseits erstaunlich anpassungsfähig oder plastisch. Wenn ein Areal beschädigt wird, kann dessen Funktionalität von anderen nach und nach Arealen übernommen werden, dies ist aber leider nicht immer der Fall.
Es wurden neue Untersuchungsmethoden entwickelt, die es erlauben, ein Gehirn bei seiner Arbeit zu beobachten, die sogenannten bildgebenden Verfahren, die Hirnaktivitäten sichtbar machen können. Wenngleich diese Verfahren in erster Linie für klinische, diagnostische Aufgaben entwickelt wurden, liefern sie auch der Grundlagenforschung Gelegenheit, tiefer in die terra incognita einzudringen. So können wir z.B. beobachten, in welchen Arealen erhöhte Aktivität auftritt, wenn wir an bestimmt Dinge denken.
Ausgehend von den Erkenntnissen über die „feuchte Hardware“, die von Medizin und Neurobiologie in Zusammenarbeit mit der Neuroinformatik und der Psychophysik, um nur einige zu nennen, gewonnen wurden über Bau, Funktion und Entwicklung von Neuronen und deren Grundbausteine, über Nervenzellverbände und Nervensysteme, wurden höhere kognitive Funktionen ins Visier genommen, die in die Wahrnehmung einerseits und die Steuerung der Motorik andererseits hineinspielen. So entstand die „kognitive Neurowissenschaft“, die auf der Grundlage der vorhandenen Hardware die höheren kognitiven Funktionen des Gehirns zu erklären versucht bzw. aufgrund von Erklärungsversuchen kognitiver Funktionen Hypothesen über die Funktionsweise der Hardware aufstellt und dann diese überprüft.
Trotz der Vielzahl der Erkenntnisse, die in den letzten Jahren von den Neurowissenschaften gewonnen wurden, wurde festgestellt, dass es schwierig wird, diesen bottom-up Ansatz konsequent weiterzuführen. Selbst wenn man später einmal in der Lage sein wird, Gehirnaktivität über einen längeren Zeitraum in hoher zeitlicher und hoher räumlicher Auflösung aufzuzeichnen, etwas, was man heute noch nicht kann, dann wird es noch ein weiter Weg sein, aus diesen Aufzeichnungen herauszulesen, womit sich dieses Gehirn tatsächlich beschäftigt hat, welche konkreten Gedanken, Fragen, Schlussfolgerungen, Erinnerungen, Gefühle in diesem Gehirn aufgetreten sind, wenn dieses überhaupt je möglich sein sollte.
Die zweite Antwort auf die Frage nach dem Untersuchungsgegenstand lautet, dass es das Erleben, Denken und Handeln ist, die höheren, kognitiven Funktionen, die im Zentrum des Interesses stehen; mit den Worten eines Informatikers also die Software. Zunächst ist man davon ausgegangen, dass die Hardware, auf der diese Funktionalität erzeugt werden kann, vernachlässigbar ist, dass man das Organ Gehirn durch ein Elektronengehirn ersetzen kann. Die dahinter stehende Annahme, dass auch ein Gehirn nichts anderes als ein informationsverarbeitendes System ist, wurde bislang nicht widerlegt und es ist auch nicht zu erwarten, dass sie widerlegt wird.
Wir bezeichnen diesen Ansatz als Top-Down-Ansatz, da, ausgehend von der Analyse hoher, beobachtbarer kognitiven Fähigkeiten, wie z.B. unserer Sprachfähigkeit, formale Erklärungsmodelle entwickelt und auf Computern implementiert werden. Die Eigenschaften dieser Modelle können so untersucht und mit den Beobachtungen verglichen werden. Die Computerlinguistik, die Kognitionspsychologie, die Künstliche Intelligenz-Forschung sind hier als Vertreter zu nennen, die dieser Tradition verpflichtet waren und zum Teil es auch noch sind.
Als Forschungsstrategie scheint dieser Ansatz jedoch ebenfalls an seine Grenzen zu stoßen. Um weiter zu kommen müssen wir wohl doch die physikalische Architektur berücksichtigen, mit der die Natur diese Funktionalität hervorgebracht hat.
Lassen Sie mich dieses an einem Beispiel erläutern: Die Sprache hebt den Menschen recht deutlich von anderen Lebewesen ab. Sie ist zunächst Untersuchungsgegenstand der Sprachwissenschaft und deren Ziele beschränken sich keineswegs darauf, Grammatiken natürlicher Sprachen zu entwickeln, die z.B. in der Schule genutzt werden können. Von Interesse sind auch die Prozesse der Sprachdynamik, der Spracherzeugung und des Verstehens von Sprache. Die Verfahren zur Simulation von Sprachverstehen, die bislang zur Verfügung stehen und in erster Linie in Zusammenarbeit mit der Informatik entwickelt wurden, haben die Eigenschaft, dass der Aufwand der syntaktischen, semantischen und pragmatischen Analyse einer Äußerung, die wir hören, mit der Länge der Äußerung exponentiell wächst, also sehr stark zunimmt. Dies müsste die Konsequenz haben, dass wir als Hörer einer Äußerung in unserem Verstehensprozess immer langsamer werden, je länger ein Satz wird, dem wir zuhören, bis wir nicht mehr folgen können, weil all unsere Rechenkapazität damit beschäftigt ist, das bereits Gehörte zu verarbeiten. Das dem nicht so ist, erleben Sie tagtäglich, hoffentlich auch jetzt. Dies signalisiert uns, dass unsere maschinellen Verfahren nicht denen entsprechen, die in unseren Gehirnen realisiert sind.
Zur Erforschung der Sprachfähigkeit des Menschen hat sich die Sprachwissenschaft mit der Informatik zusammengetan, um die Theorien anhand von Simulationen zu überprüfen aber auch weiterzuentwickeln. Hieraus ist die Computerlinguistik entstanden. Sie hat sich auch mit der Hirnforschung und der Psychologie zusammen getan und die Psycholinguistik geschaffen, die z.B. untersucht, wie unser Gedächtnis den Sprachverstehensprozess unterstützt, welche alternativen Lesarten von Lexemen wann aktiviert und wann deaktiviert werden bis hin zur Verteilung der Sprachzentren auf die unterschiedlichen Regionen im Hirn, also der physikalischen Architektur des sprachbeherrschenden Systems.
Das oben angedeutete Problem scheint nur lösbar, wenn man in Rechnung stellt, dass das Hirn den größten Anteil seiner Verarbeitungskapazität auf die Vorhersage der zugegebener Maßen nahen Zukunft verwendet und dann sich insbesondere mit den beobachteten Abweichungen befasst. Hinzu kommt, dass unser sprachliches Wissen Erfahrungswissen in dem Sinne ist, dass nicht alle Worte in jeder Situation gleichermaßen wahrscheinlich sind, sondern dass unserer Sprachkompetenz komplexe Strukturen zugrunde liegen, sogenannte Mehrwortlexeme, die wir als Einheit sowohl bei der Spracherzeugung als auch dem Sprachverstehen verwenden und situationsspezifisch abwandeln. Und letztlich spielt eine Rolle, dass wir uns mit einer bestimmten Ebene des Verstehens zufrieden geben, eine Ebene, die von den konkreten Handlungszusammenhängen bestimmt wird, in denen wir agieren. Es ist nicht notwendig und auch nicht sinnvoll, in jeder Situation jede mögliche Mehrdeutigkeit eines sprachlichen Ausdrucks auflösen zu können. Die quantitative Linguistik liefert uns Hinweise nach den wahrscheinlichsten oder häufigsten Interpretationen.
Erst die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen wird es uns möglich machen, eine befriedigende Theorie der Sprachbeherrschung zu entwickeln. Und dafür ist es notwendig, dass wir sowohl top down als auch bottom up an diese Fragen herangehen und dies miteinander, nicht nebeneinander.
Die Vision des Miteinanders der Disziplinen, des Zusammenwirkens der Neurowissenschaften mit den Kognitionswissenschaften, der interdisziplinären Arbeit an einem Untersuchungsgegenstand, bei der die Grenzen der Fächer in den Hintergrund treten zugunsten des gemeinsamen Erkenntnisgewinns, in dieser Vision liegt die Chance und die Perspektive unseres Instituts. Ich gebe gerne zu, dass wir nicht die einzigen sind, die auf diesen Gedanken gekommen sind. Die Zusammenarbeit hat längst angefangen. Wir gehören aber zu den ersten, die dieses in einem Institut unter einem Dach gezielt angehen.
Möglicherweise ist Ihnen die Bezeichnungsvielfalt aufgefallen, die ich verwendet habe: Ich sprach von der Kognitionswissenschaft (Singular) und den Kognitionswissenschaften (Plural). Die Rede war auch von der Hirnforschung, den Neurowissenschaften (Plural) und der kognitiven Neurowissenschaft (also Singular). Was nun? Ich hoffe, dass deutlich geworden ist, dass diese Bezeichnungen unterschiedliche Wurzeln haben. Ich persönlich verwende am liebsten den englischsprachigen Begriff Cognitive Science, in dem für mich die Neurowissenschaften und die Kognitionswissenschaften in gleichen Teilen enthalten sind.
Ich möchte Ihnen nun die Mitglieder des Instituts vorstellen und entsprechend meiner Ausführungen erwartet Sie ein bunter Strauss verschiedenster Arbeitsgruppen:
- Philosophie des Geistes / der Kognition: Prof. Dr. W. Lenzen, PD Dr. A. Stephan (Hier wird z.B. die Frage des Sich-Selbst-Bewusst-Seins bearbeitet.)
- Computerlinguistik, Sprachwissenschaft und Psycholinguistik: Dr. P. Ludewig, Prof. Dr. P. Bosch, Prof. Dr. W. Thümmel, Prof. Dr. R. Weingarten (Hier werden z.B. Schreibprozesse und Fragen der Bedeutung sprachlicher Äußerungen untersucht sowie intelligente Sprachlehr- und -lernsysteme entwickelt)
- Kognitionspsychologie, Persönlichkeitspsychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie: Prof. Dr. F. Schmalhofer, Prof. Dr. J. Kuhl und PD Dr. K.-Ch. Hamborg (Hier stehen Problemlösen und kognitive Modelle, Fragen der Motivation und die Benutzbarkeit von Software im Zentrum)
- Künstliche Intelligenz und Theoretische Informatik: PD Dr. U. Schmid, Prof. Dr. V. Sperschneider, Prof. Dr. C. Rollinger (Hier wird z.B. über Planen, Intelligente Lehr- und Lernsysteme gearbeitet)
- Neurobiologie und Neurobiopsychologie: Prof. Dr. G. Jeserich, Dr. M. Herzog (Hier stehen Fragen der Funktionsweise des visuelles Systems und der Wahrnehmung im Vordergrund)
Der Aufbau ist jedoch noch nicht abgeschlossen, derzeit laufen drei Berufungsverfahren: Eines haben wir in der Neuroinformatik, ein zweites in der Philosophie der Kognition und ein drittes in der Neurobiopsychologie. Erst wenn diese Stellen besetzt sein werden und ich denke, dass dieses im kommenden Jahr der Fall sein wird, werden wir komplett sein.
Ich hoffe, dass wir, die Mitglieder des Instituts, die beteiligten Fachbereiche und der Senat dieser unserer Universität mit der Errichtung des Instituts nicht nur den Rahmen für die Cognitive Science richtig abgesteckt haben, sondern dass wir uns auch gemeinsam dafür einsetzen, dass das Institut leben und sich entfalten kann. Eine der wichtigsten Voraussetzungen hierfür ist das gemeinsame, physikalische Dach des Instituts, das der Herr Präsident in seiner Rede bereits erwähnt hat. Ohne dieses Dach werden wir es schwer haben, zumal wir derzeit auf fünf Lokationen verteilt sind und im Zusammenhang mit den Neuberufungen die Gefahr besteht, das weitere hinzukommen.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein Grußwort übermitteln, das mir der Vorsitzende der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft geschickt hat, dem es leider nicht möglich war, heute an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich zitiere:
„Der Vorstand der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft freut sich sehr darüber, eine Mehrzahl der im Institut für Kognitionswissenschaft engagierten Kollegen unter ihren Mitgliedern zu haben, und über den fortgesetzten Zulauf an jungen, neuen Mitgliedern aus Osnabrück. Mit der Ausrichtung unserer Fachtagung in Verbindung mit der Europäischen Cognitive ScienceTagung im nächsten Jahr macht ihr Eure wahrhaft aktive Mitgliedschaft deutlich.
Nicht allein deshalb, sondern vor allem wegen des großen Dienstes, den die Universität Osnabrück mit einem vorbildlichen und erkennbar erfolgreichen Cognitive-Science-Programm für die Entwicklung der Kognitionswissenschaft in Deutschland erbringt, übermittle ich hiermit im Namen des Vorstandes der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft beste Glück- und Erfolgswünsche und grüße alle Teilnehmer auf das herzlichste."
(Ipke Wachsmuth, Vorsitzender der GK)
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
(Prof. Dr.-Ing. Claus R. Rollinger, Direktor des Instituts für Kognitionswissenschaft,
zur Institutseröffnung am 20. November 2002)